Texte
Lebensweltbezogene Methoden in der Kinder- und Jugendarbeit als Handlungsorientierung und –anleitung
- Details
- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:48
Beitrag für den Band "Handbuch Methoden der Kinder- und Jugendarbeit", hg. von Karl-Heinz Braun, Bernd Dobesberger, Konstanze Wetzel u.a., LIT-Verlag (Münster/Wien) 2005.
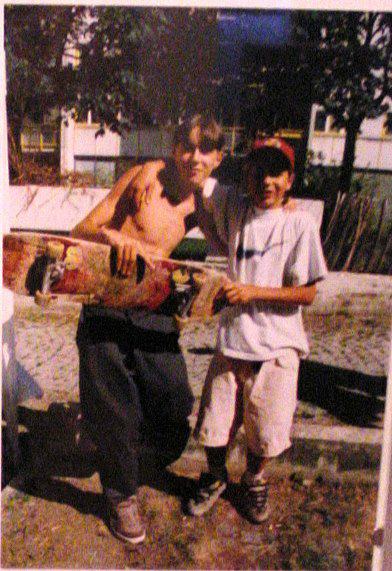
Kinder, Jugendliche, Erwachsene leben in der Welt, wo sonst sollten sie es tun? Die Welt ist eine Lebenswelt in dem Sinne, als sie voll mit Leben ist. Mit pflanzlichem, tierischem, menschlichem Leben, das sich hier ereignet. Zumindest gilt dies für jenen kleinen Ausschnitt des Kosmos, genannt Planet Erde, den wir Menschen bevölkern, be-„ackern“, gestalten.
Wenn in der Sozialen Arbeit von „Lebenswelt“ die Rede ist, dann ist allerdings nicht diese Welt im Allgemeinen gemeint, sondern eine besondere Welt.
1.2.1 Lebenswelt
Jeder Mensch hat seinen Platz in der Welt, sieht sie mit seinen eigenen Augen, anhand der eigenen Erfahrungen. Von jedem Ort aus schichtet sie sich anders auf. Andere Personen und Dinge sind nahe, während manche für diese Person unsichtbar sind, jenseits des Horizonts.
Pipilotti Rist hat vor einigen Jahren ein Kunstprojekt realisiert: Personen wurden aufgefordert, sich selbst als Zentrum ihrer Welt, der Welt zu verstehen. Die menschliche Welt sei ein Multiversum, bestehend aus 6 Milliarden Welten mit je einem Menschen als Zentrum, als Ausgangspunkt eines Koordinatensystems. Diese Sicht hat auch die lebensweltorientierte Soziale Arbeit.
Der Begriff „Lebenswelt“ bezeichnet also eine subjektive Topografie: Die Welt von einem personalen Zentrum aus gesehen und gedeutet. Ich will diesen Satz erläutern.
Zuerst bezeichnet der Begriff Lebenswelt eine Welt, und zwar eine Welt mit allem, was dazugehört: eine von Menschen geschaffene gegenständliche und soziale Welt. In ihr gibt es Gelände und Gegenstände, es gibt Regeln und Machtverhältnisse, Bedingungen und Möglichkeiten. Diese Verhältnisse sind insofern objektiv, als sie auch unabhängig von der Wahrnehmung der Person existieren. Die Person kann sich darüber auch täuschen. Sie sind aber immer auch unhintergehbar subjektiv. Jede Person ist alleinige Expertin ihrer Lebenswelt, sie hat die meisten Kenntnisse darüber, vor allem Kenntnisse über das, was ihr im Verlauf ihres Lebens auf diesem Planeten widerfahren ist, über ihre Erfolge und Misserfolge, über ihre Empfindungen und Erfahrungen, ihre Lebensschwierigkeiten und Freuden. Sie muss mit diesem Körper (mit seinen Möglichkeiten und Begrenzungen), mit diesen Verwandten, mit diesem sozialen und geschichtlichen Ort zurechtkommen, unter diesen Bedingungen ein Leben führen. Ein Leben führen, das heißt nicht nur dahinleben, sondern das heißt auch aktiv zu sein, um sich Lebensmittel zu beschaffen, einen Schlafplatz zu sichern, sich Erholung zu verschaffen, Gesprächspartner usw. – das heißt aber auch, sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen, damit zufrieden oder unzufrieden zu sein, Angst zu haben und trotz der Angst versuchen handlungsfähig zu bleiben. Und so weiter und so fort. Diese subjektive Welt des Alltags, der Lebensführung, das ist die Lebenswelt, die hier gemeint ist. Bei den Versuchen der Lebensführung sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene, immer wieder mit Bedingungen konfrontiert, deren Wirkmechanismus von ihrem Ort aus nur bedingt zu durchschauen ist.
Wie man sieht, setzt dieser Lebensweltbegriff (1) immer ein personales Zentrum voraus. Wir müssen dieses Zentrum benennen, wenn wir von einer konkreten Lebenswelt sprechen. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit ist immer auch subjektorientierte Soziale Arbeit, versteht ihre KlientInnen als GestalterInnen ihres Lebens – allerdings immer wieder auch unter schwierigen, schwer durchschaubaren, hindernden Bedingungen. Lebensweltorientierung kann also auf zwei Arten von Veränderung zielen – und sollte das auch gleichzeitig tun: Auf eine Unterstützung der Personen bei der Findung ihres Weges und auf eine Vergrößerung ihrer Chancen durch die Beeinflussung ihres lebensweltlichen Umfelds (oder, einfacher: ihres Lebensfeldes).
1.2.2 Alltag
Eine zweites tragendes Element des Lebenswelt-Ansatzes in der Sozialen Arbeit ist der Bezug auf den Alltag. Und auch hier ist Alfred Schütz der Ahne, der sich mit den Besonderheiten des Alltags auseinandergesetzt und sie beschrieben hat (2).
Alltag meint die alltägliche Lebensführung, in der Menschen essen, trinken, schlafen, arbeiten, sich pflegen etc. müssen. Die Bewältigung dieses Alltags ist eine Aufgabe, manchmal eine anspruchsvolle. Soziale Arbeit stellt immer diese Frage nach dem Alltag: Wie schaffen es die Leute, oder wie können sie es schaffen, „unter der Bedingung von …“ einen gelingenden Alltag zu Stande zu bringen.
„Unter der Bedingung von …“, diese Formel macht das Fenster zu all dem auf, was gemeinhin als „Problem“ verstanden wird, macht es sichtbar, lässt den Fokus aber doch auf den in der Sozialen Arbeit interessierenden Bereich. Soziale Arbeit beseitigt keine körperlichen Behinderungen, kann nicht Sucht heilen, Diskriminierung nicht verhindern. Was sie leisten kann und täglich leistet, ist, Unterstützung beim Versuch zu geben, unter der Bedingung von Sucht, Behinderung, Diskriminierung etc. Alltag zu organisieren, ein gelingendes Leben zu führen.
Die Konzentration auf den Alltag legt pragmatische Lösungen nahe. Es geht nicht um das Ideale, sondern es geht um das Machbare. Und um zu erkennen, was bei den Kindern/Jugendlichen, bei meinen KlientInnen machbar ist, was die pragmatischen Lösungen wären, dazu benötigt man die Kenntnisse über die Lebenswelt und die alltägliche Lebensführung. So verbindet sich die Alltagsorientierung mit der Lebensweltorientierung: Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
1.2.3 Das Konzept der Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit
Nun gut, nun wissen wir, was mit Lebenswelt und Alltag in der Diskussion der Sozialen Arbeit gemeint ist. Aber was hat das mit dem Selbstverständnis und der Methodik der Sozialen Arbeit zu tun? Lebenswelt- und Alltags-bezogene Konzepte der Sozialen Arbeit setzen einen Schwerpunkt: Sie betonen die reale Welt der KlientInnen. Ihnen geht es weniger um die Unterscheidung von „angepasst“ / „deviant“. Sie schlagen einen Verzicht vor: Den Verzicht darauf, von vornherein zu wissen, wo die KlientInnen hin sollen.
Zuallererst betont das Lebensweltkonzept die Unwissenheit der SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen. Es betont die Differenz zwischen deren Weltsicht und der Weltsicht der KlientInnen. Was wissen wir schon von deren Lebenswelt?
Wir wissen nicht, was richtig ist, ja wir wissen vorerst nicht einmal, wie sich die Welt für jene entfaltet, mit denen wir arbeiten. Was ist ihr Horizont, was sind die stärksten Bezüge, was ist ihnen wichtig und was weniger wichtig?
Dieses Unwissen wird zum Ausgangspunkt methodischen Handelns gemacht. Konsequenterweise steht daher bei allen lebensweltbezogenen Methoden die Annäherung an die Welt der KlientInnen im Zentrum.
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit braucht also ein Konzept der Annäherung, sonst kann es sie nicht geben. Am deutlichsten kann man das wohl durch die Beschreibung eines Gegensatzes machen: Was wäre das gerade Gegenteil von Lebensweltorientierung? Nun, das wäre eine Soziale Arbeit, die sich starke eigene Strukturen aufbaut und dann wartet, ob die KlientInnen kommen. Wahrgenommen würden jene werden, die kommen, nicht jene, die nicht kommen. Die Einrichtung hätte ein fixes Programmangebot, und mit Spezialisierung versuchte man vielleicht die Qualität des Angebots zu verbessern.
Eine lebensweltorientierte Organisation würde ihre Zielgruppe suchen, wäre bereit, sich überraschen zu lassen von dem, was sie „vor Ort“ findet, würde als Organisationsprinzip nicht die Spezialisierung, sondern im Gegenteil die Entspezialisierung und Alltagsnähe betonen.
Das erste große Thema ist dann die Annäherung an die Lebensfelder der Zielgruppen. Das zweite Thema wäre die – zumindest partielle – Gewinnung der subjektiven Perspektive der Personen in diesem Feld. Das dritte Thema ist das inhaltliche Ziel unserer Expedition in die Fremde. Und das vierte Thema wäre das des Rückzugs.
1.2.3.1 Die Annäherung
Annäherung ist die Voraussetzung für die Intervention. Zuallererst heißt Annäherung, dort hinzugehen, wo unsere Zielgruppen sind, und wo sie sich zumindest dem Risiko aussetzen, auch gesehen zu werden: Jene Plätze, die sie im öffentlichen Raum nutzen und belegen. Dort sehen wir sie, dort können wir Kontaktversuche starten, dort sehen wir auch, was sie sehen. Wir sehen die Höfe der Wohnanlagen, wir sehen die Menschen, die sich sonst noch breit machen in diesem Raum. Und wir erahnen zumindest, wer Macht hat in diesem Raum. Die Struktur und die Möblierung weisen uns darauf hin, das Vorhandene und das Fehlende. Vorläufig sehen wir noch mit unseren Augen eine öffentlich zugängliche Welt, die Chancen eröffnet und andere Chancen verweigert. Wir können sie beschreiben. Wir sehen unser Klientel sich in dieser Welt bewegen.
Was wir nicht sehen können, ist der nicht-öffentliche Teil des Lebens von Personen unserer Zielgruppen. Ihre Wohnung, ihr familiäres Leben, ihre Schulklasse oder Arbeitsstelle. Und wir sehen nicht, ob sie sich auch noch in anderen öffentlichen Räumen in einer anderen Rolle bewegen. Wir sehen ein Lebensfeld, das oftmals für Personen aus unserer Zielgruppe nur eines ihrer Lebensfelder ist, wenn auch ein wichtiges.
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit versucht, das Funktionieren der „natürlichen“ sozialen Biotope zu erkennen und zu begreifen. Man könnte die Haltung so beschreiben: Wir wissen, dass das funktioniert, aber wir wissen noch nicht wie. Wir wollen diesem Funktionieren auf die Spur kommen, sind hochinteressiert. Was wir nicht wissen, ist, wie man es besser machen könnte.
Lebensweltorientierung akzeptiert also die Personen in ihren gegebenen Zusammenhängen, hat Achtung vor der Autonomie ihres Lebens und vor den Lebensentscheidungen, die sie bisher getroffen haben. Sie nähert sich den Lebensfeldern nicht mit einem missionarischen Gestus. Vorerst will man niemanden aus ihnen „erretten“.
In dem Maße, in dem wir uns im Lebensfeld unseres potenziellen Klientels neugierig beobachtend und recherchierend bewegen, sind auch wir sichtbar, werden beobachtet. Schon die erste Annäherung ist eine Intervention, wir gehören bald zum Feld, allerdings vorerst – und auf geraume Zeit – als Fremde.
Fremd müssen wir auch bleiben, denn diese Fremdheit ist eine Ressource. Sie bringt eine Außensicht in die Lebenswelt, die zwar manchmal unangenehm, immer wieder aber auch nützlich ist für die KlientInnen. Sie verhindert unsere völlige Involviertheit in das Geschehen vor Ort. Und sie stärkt uns, indem wir unsere Auftritte immer wieder auf dem sicheren Terrain unserer professionellen (oder auch ehrenamtlichen) Welt im Team und in der Supervision bzw. Praxisreflexion vorüberlegen und nachbesprechen können.
Im Gepäck haben wir einige weitere Ressourcen (Zeit, Wissen, soziales Kapital, Zugang zu Räumen oder Geld). Welche dieser Ressourcen nun für die Betroffenen nützlich sein können, das wird sich erst weisen, das wird man mit ihnen verhandeln. Für das Verhandeln ist allerdings auch eine Kontaktaufnahme erforderlich – und bei der Kontaktaufnahme geben wir uns als Fachkräfte zu erkennen (als JugendarbeiterIn, als SozialarbeiterIn, als StreetworkerIn). Gestaltet man diesen Zugang hinreichend offen, so setzt bald ein gegenseitiges Beforschen ein: Wir wollen was über unsere Gesprächspartner wissen, und sie wollen etwas über uns wissen. Ein gutes Geschäft, eine gute Basis für Vertrauensaufbau.
Trotzdem: Annäherung ist immer auch ein Eindringen, eine Zumutung. Und selbst nach respektvoller Annäherung ist ab und zu Zurückweisung zu erwarten. Lebensweltorientierte Sozialarbeit muss dieses Spannungsfeld aushalten: Nachgehen ist nötig, aber es ist immer auch wieder einmal zuviel, wird von den Betroffenen als zu aufdringlich oder als jetzt nicht passend erlebt. Trotzdem wird man es wieder respektvoll versuchen.
Worin besteht eigentlich die Legitimation für diesen Übergriff, für das interessierte Eindringen in die Lebensfelder der Zielgruppen, der KlientInnen? Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind letztlich „AgentInnen des Gemeinwesens“, der staatlich und zivilgesellschaftlich organisierten Gesellschaft. Sie prozessieren bezahlt und mit den Mitteln der SteuerzahlerInnen und SpenderInnen die Sorge um Mitglieder dieser Gesellschaft, von denen angenommen wird, dass es ihnen nicht so gut geht. Das wäre eine positive Beschreibung. Natürlich kann man diese Sorge auch etwas harscher als Etablierung sozialer Kontrolle über deviante MitbürgerInnen beschreiben. In beiden Fällen gilt, dass Legitimation und Bezahlung von „der Gesellschaft“ kommt. Und dass die potenziellen KlientInnen und die KlientInnen das in aller Regel auch so sehen: Nicht umsonst gibt es bei ihnen ein gewisses Misstrauen den Annäherungsversuchen der Profis gegenüber.
Schon dieses Misstrauen ist ambivalent: Wenn die SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen RepräsentantInnen jener Gesellschaft sind, die Chancen vorenthält, so sind sie doch auch mögliche Verbindungsglieder zu Chancen, die bisher nicht wahrgenommen werden konnten. Sie repräsentieren Chancen der Inklusion.
Lösen lässt sich dieses Dilemma der Beauftragung durch die Vertreter der (Ordnungs-)Macht (in der Sozialen Arbeit als „doppeltes Mandat“ diskutiert) nicht durch Verleugnung oder durch Anbiederung, sondern durch die Inszenierung einer Sonderstellung, durch einen Bezug auf ein weiteres Drittes, die Werte und Zielsetzungen der Profession. Und lösen lässt sich das Dilemma dadurch, dass so gehandelt wird, dass Vertrauen gerechtfertigt erscheint, nicht Belehrung im Vordergrund steht.
Oder anders gesagt: Respekt ist die notwendige Voraussetzung der Annäherung. Das Angebot, für die Verwirklichung von Chancen (und seien sie auch noch so klein) Ressourcen zu mobilisieren, kann attraktiv sein. Auf diese Attraktivität baut lebensweltorientierte Soziale Arbeit.
Hans Thiersch formuliert den Anspruch der Annäherung so: „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit agiert in Lebensverhältnissen, d.h. in den gewöhnlichen, vielfältigen, alltäglich pragmatischen Verhältnissen und sucht, dass sie Menschen dort stabilisiert und kräftigt.“ (3)
Dorthin müssen wir also hin mit unseren Unterstützungen. In die gewöhnlichen, vielfältigen, alltäglich pragmatischen Lebensverhältnisse.
Dazu bedarf es allerdings eines weiteren Schritts, denn der Ausschnitt des öffentlichen Raums, in dem sich die Kids und Jugendlichen bewegen, ist eben nur ein Ausschnitt ihrer Lebensverhältnisse, wenn auch jener Ausschnitt, der uns relativ leicht zugänglich ist, der Ausschnitt in dem sie auffallen, und ein Ausschnitt, der für ihre jugendliche Sozialisation und Individuation recht bedeutend ist. Es ist aber nicht unbedingt der Raum, der über ihre Lebenschancen entscheidet.
Um jenen weiteren Raum zu gewinnen, benötigen wir den zweiten Schritt, bzw. müssen wir uns mit dem zweiten Thema lebensweltorientierter Organisation Sozialer Arbeit beschäftigen:
1.2.3.2 Die Gewinnung der subjektiven Perspektive der Personen im Feld
Wenn wir oben die Lebenswelt als eine personenzentrierte beschrieben haben, so wird ein lebensweltlicher Zugang nicht ohne einem Zugang zu den Personen auskommen können, einem Zugang zu ihrer Beschreibung ihres (Alltags-)Lebens. Damit gewinnen wir
a) Kenntnisse über andere, uns vorerst nicht sichtbare Sektoren ihres lebensweltlichen Umfelds (Familie, FreundInnen, Arbeit)
b) Kentnisse über ihre Wahrnehmung der Welt, vor allem der alltäglichen Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Lebensführung
c) Kenntnisse über das, was sie als problematisch erleben, über ihre Wünsche, Hoffnungen und Enttäuschungen.
Nun ist lebensweltorientierte Soziale Arbeit zwar immer auch ein Forschungsprojekt, das Lebenswelten zu erkunden sucht, aber diese Erkundung ist nicht Selbstzweck. Sie wird nicht veranstaltet, um die gewonnenen Erkenntnisse dann niederzuschreiben und einer wissenschaftlichen Community zugänglich zu machen. Die Erkundung dient der Organisation einer passenden Unterstützung. Sie dient dazu, Möglichkeiten ausfindig zu machen, wie den Personen (KlientInnen, Jugendlichen) bei ihrer autonomen Lebensführung beizustehen wäre. Sie dient der Erhöhung von deren Chancen auf Inklusion, auf ein gelingendes Leben.
Der Versuch, die subjektive Perspektive der Jugendlichen zu erfassen, ist also ein Versuch, sie überhaupt als Personen wahrzunehmen, mit ihnen in einen nicht bloß einseitig belehrenden Dialog über ihr Alltagsleben eintreten zu können.
Ein Weg dazu ist das Gespräch, und zwar ein Gespräch, das den Kindern, Jugendlichen Raum für ihre Erzählungen gibt. Ein Gespräch, das ihnen ermöglicht, auf ihre Art, in ihrem Duktus, über ihr Alltagsleben zu sprechen. Unser Interesse muss deutlich sein, darf sie aber nicht allzusehr drängen, und ein Frage- und Antwortspiel mit zu engen Fragen zwingt den GesprächspartnerInnen die Wahrnehmungsstruktur der InterviewerInnen auf.
Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit stehen mit Theater- und Rollenspiel, mit dem Bereitstellen von Foto- und Videokameras und ähnlichen Angeboten noch reiche Möglichkeiten zur Verfügung, die Formulierung und/oder Darstellung der je eigenen Perspektive auf die Welt zu ermutigen und zu ermöglichen.
Im engeren Sinne problemlösend wird die Arbeit dann, wenn die Kinder/Jugendlichen Probleme formulieren – Lebensführungsprobleme. Dann kann die Kommunikation mit ihnen die Form der Beratung annehmen, wobei Beratung bekanntlich nicht in erster Linie – aber möglicherweise auch – heißt, Ratschläge zu geben. Manchmal kann diese Beratung durch Interventionen im Feld, zum Beispiel durch Gespräche mit den Eltern, ergänzt werden.
Die Nähe, die man durch diese Bemühungen um die Gewinnung der Perspektive der Kinder, Jugendlichen erreicht, ist auch verpflichtend: Das so errungene Vertrauen verpflichtet dazu, Unterstützung zu geben, wenn nötig und/oder gefordert.
Das führt uns zum dritten Thema:
1.2.3.3 Das Ziel der Lebenswelterkundung
Wir bleiben zwar Fremde in der Welt der Kinder/Jugendlichen und ihrer Bezugspersonen, werden aber doch zum Bestandteil dieser ihrer Lebenswelt. Dort nicht dauerhaft verankert, in unserer eigenen Lebensführung nicht abhängig von den Logiken und Dynamiken der Lebenswelten, geht unsere Aufgabe über das voyeuristische Moment hinaus. Ausgestattet mit Wissen über die Wege zur Inklusion in gesellschaftliche Funktionssysteme und über die Bewältigungsmöglichkeiten von Lebensführungsproblemen haben wir eine Bringschuld.
„Die spezifische Aufgabe hängt zusammen mit Entwicklungen innerhalb unserer Gesellschaft, also mit Erosionen und Verwerfungen in lebensweltlichen Verhältnissen, in dem, was man entweder als Individualisierung und Pluralisierung von Lebenswelt beschreiben kann oder mit Lothar Böhnisch als die neue Normalität von anomischen Lebensverhältnissen. Die Tatsache also, daß man sich den Lebensverhältnissen widmen muss, sich auf sie einlassen muss und in ihnen agieren muss, ist Indiz der Krise, der Belastung, der Überforderung und der Schwierigkeit in eben dieser Lebenswelt. Es braucht hier Hilfen und Unterstützungen. Dass sie gegeben werden müssen, ist das erste, es erzeugt Soziale Arbeit als ein eigenständiges Angebot und (als) Arbeit (an) der Bewältigung von Lebensverhältnissen, des Zu-Rande-Kommens in Lebensverhältnissen oder der Integration im Medium von lebensweltlichen Aufgaben und Geschäften.“ (4)
Gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind PädagogInnen und SozialarbeiterInnen auch als Erwachsene gefordert: Als jene, von denen mit Recht verantwortungsvolles, unterstützendes und schützendes Handeln erwartet werden kann – nochmal deutlicher, wenn sie in einer beruflichen Rolle mit Jugendlichen zu tun haben. Es geht also letztlich um lebensweltlich angemessene Sorge („Care“). Eine Hilfe, die die Autonomie der Betroffenen respektiert und in Rechnung stellt, sie aber trotzdem nicht alleine lässt.
Lebensweltlich orientierte Unterstützung will für die KlientInnen nicht Ersatzwelten bauen, sondern ihnen ein fuktionierendes Alltagsleben dort ermöglichen, wo sie sind oder wo sie hinkönnen, hinwollen. Es versucht, keine Brüche zu produzieren, sondern Entwicklungen zu ermöglichen. Manche nennen das eine „Empowerment-Perspektive“ und meinen damit eine Stärkung der eigenen Kräfte zur Lebensbewältigung und zur Durchsetzung eigener berechtigter Ansprüche.
1.2.3.4 Der Rückzug
Das vierte Thema kreist um die Grenzen der Lebensweltannäherung, und zwar um Grenzen der Intensität und um zeitliche Grenzen.
Lebensweltorientierte Arbeit sucht die Nähe, daher ist sie besonders gefährdet, „übergriffig“ zu werden, sich aufzudrängen und hineinzudrängen in Welten und Bezüge, die besser der autonomen Verfügung der KlientInnen (also der Personen, die in dieser Welt tatsächlich ihr Leben gestalten müssen) überlassen blieben. Ein gewisser Schutz vor dieser Übergriffigkeit ist schon durch die Regeln der Annäherung gegeben: Ohne Respekt und einer Achtung vor den Grenzen der Betroffenen werden sie uns meist ohnehin vom Zugang ausschließen, vor allem vom Zugang zu den Bereichen ihrer Lebenswelt, die nur über sie selbst zugänglich sind. Das sind vor allem die Bereiche, die ich beim zweiten Thema beschrieben habe. Aber zum einen haben wir auch Zugänge, die nicht unter der Kontrolle der Kinder/Jugendlichen sind (z.B. Elternkontakte), zum anderen besteht eine Gefahr, die die Ethnologie als „going native“ beschreibt.
Going native, damit ist die Illusion der ethnologischen Forscherin gemeint, dazuzugehören zur von ihr untersuchten Ethnie oder gesellschaftlichen Gruppe; das Übernehmen der Wertungen dieser Gruppe, der Verlust der Distanz. Wir alle kennen die „Berufsjugendlichen“, die lächerlich wirken, weil sie sich selbst noch als Jugendliche erleben, was seltsam kontrastiert zu ihren tatsächlichen lebensweltlichen Zusammenhängen, ihrer Abgesichertheit und zu ihrem Alter. Die Zugehörigkeit ist eine Illusion, und sie behindert sie dabei, ihre Aufgabe zu erfüllen.
Wenn wir uns auf die Lebenswelten unserer KlientInnen einlassen, dann ist „going native“ bis zu einem gewissen Grad erwünscht: Die Wertungen unserer KlientInnen werden uns (selbst)verständlich. Wenn wir allerdings unsere Aufgabe erfüllen wollen, müssen wir auch unsere Nicht-Zugehörigkeit als Qualität entwickeln, denn nur durch sie können wir unterstützend sein. Das Problem von Nähe und Distanz kann und soll nicht durch eine einmalige Positionierung gelöst werden. Stellen Sie sich einen Tanz vor, mit Partnerwechsel wie beim Volkstanz: Man muss reingehen in die Lebenswelt, aber auch wieder raus, wir brauchen noch andere PartnerInnen. Die wichtigsten anderen PartnerInnen sind die Angehörigen meiner Berufsgruppe, meiner Profession. Von dort beziehe ich mein Wissen, dort kann ich über meine Expeditionen in andere Lebenswelten reden. Das Team, die Supervision, die Fachliteratur, Tagungen, das sind die Absicherungen, dass ich meine Arbeit weiter gut machen kann und in den von mir sonst aufgesuchten Lebenswelten gleichzeitig heimisch und fremd bleiben kann.
Rückzug ist also eine alltägliche Aufgabe: Alltägliche Rückzüge, damit ich wieder hineinkann in die Welten von anderen. Rückzug ist allerdings auch ein inhaltliches Thema. Ich sollte mich dann aus den Welten meiner KlientInnen, der Kinder und Jugendlichen, zurückziehen, wenn die ganz gut allein zurecht kommen. Wenn ich das nicht tue, dann wird aus meiner unterstützenden Tätigkeit eine „fürsorgliche Belagerung“, ein Hineinregieren in eine Welt, die ohne mich auch nicht schlechter, vielleicht sogar besser funktioniert.
Lebensweltorientierte Arbeit muss diese Kunst beherrschen: Respekt als Voraussetzung für die Annäherung, Respekt aber auch als Kriterium für den Rückzug.
1.2.3.5 Lebensweltorientierung und ehrenamtliche Arbeit
Das hier skizzierte Konzept lebensweltorientierter Arbeit mag anspruchsvoll erscheinen, und es ist auch anspruchsvoll. Es erfordert gute Selbstkontrolle und einen soliden Hintergrund von KollegInnen, die mein „going native“ ebenso kritisch begleiten wie die aus meiner eigenen sozialen Positionierung herrührenden Abwehrtendenzen. Personen, die keine fundierte Ausbildung haben, die ihnen diese Beziehungsgestaltung ermöglicht, sind in der Jugendarbeit und in anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit allerdings keine Seltenheit.
Die Gefahr, dass Laien, die guten Willens sind, sich überfordern, ist natürlich gegeben. Es ist nachgerade typisch, dass sie in ihrem Engagement in jede nur erdenkliche Falle tappen. Das ist nicht ganz so schlimm, weil sie etwas zu bieten haben, das kein professionell Ausgebildeter bieten kann: Sie bringen ihr unmittelbares Engagement ein, sie sind glaubwürdig, weil sie nicht bezahlt, sondern als BürgerInnen agieren. Zu Recht sind die meisten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen von sozialen Non-Profit-Organisationen darauf auch stolz.
Dieses Engagement schützt aber nicht vor den Unfällen der Annäherung an fremde Lebenswelten. Daher haben engagierte Laien das Recht auf systematische Unterstützung durch jene, die organisierte Hilfe gelernt haben. Und sie haben – schon im eigenen Interesse – auch die Pflicht, diese Hilfe anzunehmen. Supervision in einem weiten Sinne, also das Besprechen der eigenen Involvierung in die Arbeit, in Beziehungen und in fremde Lebenswelten, sollte für die im Feld tätigen Laien selbstverständlich sein: Selbstverständlich gewährt werden und selbstverständlich in Anspruch genommen werden – sei es als Ehrenamtlichenteam unter Leitung von erfahrenen Profis oder als Supervision im engeren Sinne, also mit einem Supervisor oder einer Supervisorin.
1.2.4 Lebenswelt und Sozialraum
Der Lebensweltbegriff, wie ich ihn nun vorgestellt habe, ist ein radikal auf das Individuum zentrierter Begriff. Was Lebenswelt ausmacht, was sie zusammenhält, ist die Person, sie ist das Zentrum. In der Literatur und im fachlichen Sprachgebrauch findet sich aber auch eine andere Verwendung des Wortes. Unter Lebenswelten werden dann jene sozialen Räume verstanden, in denen sich bestimmte Personengruppen bewegen. Die Rede ist von „Lebenswelt Stadtteil“, „Lebenswelt Straße“ und so weiter.
Ich bevorzuge, in diesem Zusammenhang von „Lebensfeld“ zu sprechen, schon um die andere Perspektive deutlich zu machen. Wenn wir über Lebensfelder sprechen, dann sprechen wir nur über die „objektiv“ sichtbare Seite von Lebenswelten. Wir sprechen über die Gestaltung des sozialen Raumes, über die dort vorfindlichen Bedingungen des Lebens und Handelns, über die Menschen, die sich darin bewegen, über die Regeln, die die Menschen dort einhalten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Während Personen ihre „Lebenswelt“ genaugenommen mit sich herumtragen, ist das Lebensfeld relativ stabil, es bleibt da, auch wenn die Person A sich daraus entfernt. Personen durchlaufen Lebensfelder, aber ihre Lebenswelt ist meistens breiter. Die Jugendclique ist ein Lebensfeld, aber die Lebenswelt des einzelnen Jugendlichen umfasst auch noch seine Eltern und Geschwister und andere Verwandte, die Wohnung, in der er lebt, seine Schule und Arbeit und so weiter und so fort. Und vor allem umfasst sie auch noch das Bild dieser seiner Welt in seinem Kopf.
Wovon also die Rede von Lebenswelten oft handelt, sind eigentlich Sozialräume : Orte, an denen sich Leben, Alltagsleben abspielt, in denen sich Menschen treffen, wo sie in Austausch treten, wo sie auftreten und ihre Chancen zu realisieren versuchen. Auch Sozialraumorientierung ist eine Handlungsorientierung in der Sozialen Arbeit und eine mögliche Organisationsform Sozialer Dienste. Sie stellt die wirklichen Lebensräume der Menschen in Rechnung, versucht an sie und deren vorhandene, mehr oder weniger gut funktionierende Strukturen des Engagements, der Kooperation und der Selbstorganisation anzuschließen.
Damit ist angesprochen, was Sozialräume auch ausmacht: Dass sie Räume der Selbstorganisation sind, in denen sich Menschen Verbindungen suchen, um tätig zu sein, um ihre „Markierungen“ zu hinterlassen, um gestaltend einzugreifen, um sich zurechtzufinden. Sozialraumorientierte Arbeit versucht einzugreifen, um diese Selbsttätigkeit zu begünstigen, zu unterstützen, zu erleichtern. Sozialraumorientierung hat so manche Ähnlichkeit mit Lebensweltorientierung: Bei beiden Arbeitsformen wird versucht, bewusst der technologischen und/oder bürokratischen Logik großer Organisationen und Programme eine Sicht entgegenzusetzen, die von den realen Lebensverhältnissen und ihrer Eigendynamik ausgeht.
Trotzdem sollte man auch die Unterschiede zwischen Sozialraum- und Lebensweltbezug beachten. Es besteht die Gefahr, dass in seiner Bedeutung übersehen wird, was den SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen nicht zugänglich und für sie nicht direkt sichtbar ist – jene Aufschichtung der Lebenswelt, die sich nur über die Personen selbst erschließt. Lebensweltorientierung kann nicht vorentscheiden, um welche Räume es geht. Denn Personen (auch Kinder und Jugendliche) bewegen sich heute in mehreren Sozialräumen. Ihre Lebenswelt übergreift Sozialräume, auch Kinder und Jugendliche sind heute mobil – teils freiwillig, teils, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Wird das übersehen, läuft man Gefahr, die Schwächen des beackerten Feldes bloß zu verdoppeln.
Methoden, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich den Sozialraum zu erschließen und anzueignen, gehören allerdings zum erfolgversprechenden Inventar einer lebensweltbezogenen Methodik.
1.2.5 Orientierung durch Lebensweltorientierte Methodik
Wie der Titel dieses Beitrags schon verspricht, bietet Lebensweltorientierung und bieten lebensweltorientierte Methoden in der Jugendarbeit Orientierung und können das Handeln anleiten. Sie tun dies allerdings auf herausfordernde Weise: Sie definieren die Arbeit als unabschließbares Abenteuer, und sie verweigern die Perspektive auf einen Rückzug in organisatorische Sonderwelten (5).
Als Beispiel für lebensweltbezogene Methodik muss oft das Streetwork herhalten. Hier zeigen sich nämlich einige Charakteristika dieses methodischen Ansatzes in schöner Deutlichkeit: Die Schwierigkeiten der Annäherung an eine misstrauische Szene; das Verlassen des geschützten Raumes des eigenen Büros; die Notwendigkeit, die Logik und die Werte der Szene zu erkennen und vorerst zu akzeptieren; das breite Spektrum zwischen Hilfe für die Szene und individualisierten Hilfen. Mit dem Bild des Streetwork im Kopf lässt sich die eigene lebensweltorientierte Arbeit, die Position, die man gerade einnimmt, anschaulich fassen.
Orientierend ist der Lebensweltbezug durch seine klare Ausrichtung auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Kinder und Jugendlichen, durch die Betonung der nötigen Differenz zwischen den Welten der Jugendlichen und denen der BetreuerInnen, durch die Zumutung, diese Differenz immer wieder gleichzeitig zu überwinden und aufrecht zu erhalten.
Nicht zuletzt nötigt Lebensweltbezug zu Respekt vor der Autonomie und den Leistungen der Kinder und Jugendlichen. Respekt vor ihren Anstrengungen, unter oft schwierigen Bedingungen ein gelingendes Leben zu führen. Respekt auch als Voraussetzung für eine Arbeit mit ihnen.
Lebensweltorientierung begünstigt eine spannende Tätigkeit in der Jugendarbeit, eine Tätigkeit, bei der man nicht nur manches zu geben, sondern auch viel zu lernen hat, von den BerufskollegInnen und freiwillig Engagierten, aber auch und vor allem von den Jugendlichen selbst. Eine Tätigkeit, bei der die Bereitschaft, klüger zu werden, Bedingung des Erfolgs ist.
(1) „Dieser“ Lebensweltbegriff, weil die Ausführungen nur auf den Lebensweltbegriff, wie er von Husserl und Schütz entwickelt wurde, zutreffen. Bei Jürgen Habermas fand sich eine andere Verwendung: Er setzte „Lebenswelt“ als Gegensatz zu „System“ (vgl. HABERMAS. JÜRGEN: Theorie des kommunikativen Handelns. Zweiter Band, Frankfurt/M. 1987, Kap.VI). Meines Erachtens ist die Habermas´sche Verwendung für die Soziale Arbeit weniger produktiv, ich verzichte daher auf eine ausführlichere Darstellung.
(2) Vgl. SCHÜTZ, ALFRED/LUCKMANN, THOMAS: Strukturen der Lebenswelt. 2 Bde, Frankfurt/M.1979/1984.
(3) THIERSCH, HANS (1998): Soziale Arbeit als praktische Utopie. In: rundbrief gilde soziale arbeit Nummer 2. S. 42
(4) THIERSCH, a.a.O., S. 42
(5) Vgl. dazu die beispielhaften Analysen unterschiedlicher Handlungsfelder der Sozialen Arbeit in PANTUCEK, PETER/VYSLOUZIL, MONIKA (Hrsg.): Theorie und Praxis Lebenswelt-orientierter Sozialarbeit, St. Pölten 1998; GRUNDWALD, KLAUS/THIERSCH, HANS (Hrsg.): Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit, Weinheim und München 2003.



