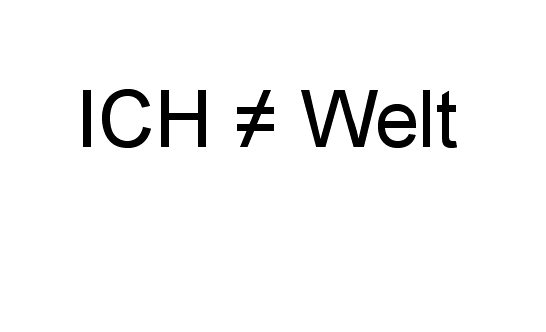Das Leben, die Selbstbestimmung.
Jeder muss sein Leben selbst führen, jede muss ihr Leben selbst führen.
Ich stelle diesen Satz, auf dem Fritz-Rüdiger Volz (1993) so beharrlich und zu Recht herumreitet, bewusst an die Spitze meiner heutigen Ausführungen.
Wir alle müssen unser Leben selbst führen, und das in einer Umwelt, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wir sind geworfen in eine Welt, die wir nicht selbst gestaltet, ja nicht einmal aus mehreren Optionen gewählt haben.
Ich verstehe das als außerordentliches Glück. Erst dieses Ausgeliefertsein gibt mir die Freiheit, böse auf die Welt zu sein. Ich bin nicht verantwortlich für sie. Ich kann unterscheiden zwischen mir und der Welt. Ich kann mich von ihr unterscheiden, ich kann eine Linie zwischen mir und der Welt, zwischen meinem Verantwortungsbereich und dem der anderen setzen. Ich kann meine Identität konstruieren. Ich gehöre zwar in gewissem Sinne zur Welt, sie aber nicht zu mir:
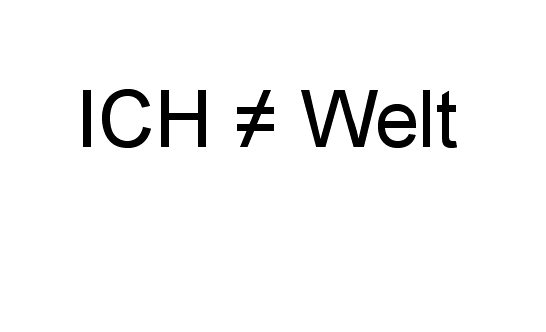
Wenn wir diese grundlegende Differenz einmal festgestellt haben, dann können wir der Frage nachgehen, die in unserem Anfangssatz steckt, der da lautete: „Jede und jeder muss sein oder ihr Leben selbst führen“. Wir können ihn ergänzen: Jeder muss sein Leben selbst führen, und das unter Bedingungen, die er sich nicht selbst ausgesucht hat.
Die Welt, das ist schon der Körper, an den ich gebunden bin, den ich nicht verlassen kann, der mir meine Existenz ermöglicht. Dieser Körper ist meine Möglichkeit, „in der Welt zu sein“. Mit ihm kann ich manches, aber beileibe nicht alles, wahrnehmen, was um mich herum passiert, und ich kann mit ihm eingreifen. Eingreifen im Wortsinne und im übertragenen Sinne. Er ist meine Schnittstelle zur Welt.
Mein Körper bindet mich an einen Ort, er situiert mich in der Welt, aber er ermöglicht mir auch das Gehen. Er „verortet“ mich, er ermöglicht mir, eine Sicht auf die Welt zu entwickeln. Er ermöglicht mir, ICH zu sein, autonom zu sein.
Und er beschränkt meine Autonomie, indem er mich manchmal unfähig macht, autonome Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel bin ich Im Schlaf ausgeliefert, Rauschzustände verlangsamen mein Denken oder täuschen meine Sinne, körperliche Zustände wie Erregung können dazu führen, dass ich handle, wie ich es im Zustande voller Handlunsgfähigkeit nie tun würde.
Die moderne Genforschung versucht, all diese Einschränkungen und Vorbestimmungen meines ICHs, meiner wachen Subjektivität, durch den Körper und seine genetische Programmierung zu kartographieren. Manche dieser Forscherinnen und Forscher lassen sich dazu verleiten, dass sie im Überschwang über ihre Entdeckungen die Existenz des ICHs, des freien Willens mit Wahlmöglichkeiten, generell in Frage stellen. So weit wollen wir hier nicht gehen, sondern ich will an der Existenz dieses ICHs festhalten. Aus gutem Grund, denn an dieses ICH richten sich die Interventionen der Sozialen Arbeit und der Pädagogik.
Unser gesellschaftliches Gefüge, das Rechts- aber auch das ökonomische System wären in ihrer jetzigen Form ohne die Annahme, der Mensch sei ein handlungsfähiges Subjekt, nicht denkbar. Wenn das denn eine Illusion sein mag, so ist es doch eine sehr nützliche Illusion.
Wenn ich also mein Leben selbst führen muss – und davon bin ich ausgegangen – dann ist die Führung meines Lebens eine Leistung meines ICHs, des autonomen Zentrums in meinem Kopf, das ich mit der Hilfe meines manchmal widerstrebenden Körpers in der Welt, deren Bestandteil ich bin, realisiere.
Eingreifen können
Und ich realisiere diese Leistung, indem ich „eingreife“, den für mich erreichbaren Teil der Welt gestalte, bearbeite, oder indem ich ausweiche und flüchte vor dem, was mir als Bedrohung dieser Lebensführung erscheint. Jede Lebensführung, auch die gelingende, auch die misslingende (an welchen Kriterien immer dieses Misslingen auch gemessen würde) wird beides beinhalten, wird die Gestaltung beinhalten und das Ausweichen.
Menschenbilder, die Personen nur als rational entscheidende und für ihre Performance – also eigentlich für die Performance ihres Körpers, denn nichts anderes ist uns sinnlich zugänglich – voll verantwortlich sehen, als auch jene, die Personen nur als Opfer sehen, sind damit im Kern unangemessen, ja inhuman.
Sie mögen sich fragen, was diese anthropologischen und vielleicht dilettantisch philosophischen Überlegungen mit der profanen Frage nach qualitätsbestimmten Vergabe- und Zuweisungskriterien in der Jugendwohlfahrt zu tun haben.
In der Debatte über die Qualität von Fremdunterbringungseinrichtungen im speziellen, von Leistungen der Jugendwohlfahrt im allgemeinen, herrscht schon keine Einigkeit darüber, was überhaupt das Produkt dieser sogenannten Dienstleistung sei, und woran denn Erfolg zu messen sei (vgl. Finkel 2003).
In der Qualitätsdebatte wird eine Terminologie verwendet, die anhand der Produktion von Gütern wie BigMacs oder Autos entwickelt wurde – und ich verstehe das als keineswegs abwertend. Bevor wir diese Terminologie auf unser Arbeitsfeld anwenden, sollten wir uns aber genau vergewissern, was Begriffe wie Produkt, Struktur, Prozess, Ergebnis oder Erfolg in diesem Zusammenhang überhaupt heißen können. Grundlegende Überlegungen sind also erforderlich.
Und ich habe nun mit dem Grundlegenden begonnen, mit der Lebensführung. Die Interventionen des Jugendamtes und die Tätigkeit der Heime und Wohngemeinschaften, sie greifen in die Lebensführung und in die Biographie ein, sie ersetzen sie nicht, können sie nicht ersetzen, aber sie ändern die Bedingungen, unter denen Eltern und Kinder ihr Leben führen können und müssen.
All das, was ich hier über Lebensführung ausgeführt habe, trifft ungemindert nicht nur auf uns Erwachsene zu, sondern ebenso auf die Kinder in den von der Jugendwohlfahrt betreuten Familien, auf die Kinder und Jugendlichen in den Heimen und WGs. Sie führen ihr Leben mit Hilfe ihrer Körperlichkeit in einer, in ihrer Welt. Niemand kann ihnen das abnehmen. Wir sehen diese ICHs gar nicht. Wir sehen ihren Körper, der für sie selbst schon Umwelt ist, ihnen teilweise fremd ist.
Den Zugang zu ihrem Subjekt-Sein, zu ihrem autonomen Zentrum, zu dem, was in ihrem und mit ihrem Körper in dieser auch unserer Welt das Leben führt, den haben wir nicht direkt. Und selbst wenn wir ihn hätten, die alten Träume von Telepathie, von unmittelbarem und direktem Verstehen, sprechen davon, selbst wenn wir den direkten Zugang hätten, so wäre die Fremdheit noch nicht aufgehoben. Weil wir uns auch selbst fremd sind. Weil wir selbst nicht immer und nicht nur vernünftig handeln. Weil die Biographie eine weite Landschaft ist, weil sie durchschlägt in unser Handeln ohne dass wir immer genau wissen, wie und warum.
Hier ist an den Grundsatz der systemischen Interventionstheorie zu erinnern, nachzulesen bei Willke zum Beispiel, oder bei Maturana: Man kann nicht direkt in ein geschlossenes, ein autonomes System intervenieren, es sei denn, indem man es zerstört.
Die Kinder und Jugendlichen, über deren Lebenschancen wir mitentscheiden, sind nicht die Werkstücke, die wir bearbeiten. Wir bewegen sie bei einer Fremdunterbringung in einen anderen Weltkontext, an einen anderen sozialen und topografischen Ort als den, an dem sie aufgewachsen sind. Ihre Herkunft ist das, was ihnen natürlich erschien.
Ihre Herkunft ist der sich selbst verstehende, immer wieder aber auch unverständliche Zustand der Welt. Ist DIE Natur, ist DIE Welt, in der sich zu behaupten sie gelernt haben. Die Auseinandersetzung mit dieser Welt, die Versuche der Selbstbehauptung in dieser ihrer Welt waren jener Weg, auf dem sie ihre Subjektivität und ihr ICH-sein bisher entwickelt haben. Sie ist vorerst die einzige Quelle und das wichtigste Referenzsystem ihres Stolzes und ihres Selbstbewusstseins.
Am anderen Ort, im Heim, der Wohngemeinschaft, sind den Kindern und Jugendlichen vorerst keine anderen Erfahrungen und Lebensstrategien zugänglich, als jene, die sie in ihrem bisherigen Leben erlernt haben. Ich weiß, ich sage banales, und Sie alle wissen das ohnehin.
Aber wir können das weiter zuspitzen: Die Kinder und Jugendlichen bleiben weiter auf sich selbst angewiesen, sie müssen weiterhin ihr Leben selbst führen. Und die Bedingungen, unter denen sie dies tun müssen, mögen nun besser geworden sein, aber es sind fremde Bedingungen, solche, auf die sie sich nicht verlassen können.
Sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Situation, in die sie nun gekommen sind, auf lange Zeit stabil bleiben wird. Sie sind ihrer Herkunftswelt heute entkommen, aber sie ist nicht aus ihrem Leben gestrichen. Nicht aus ihrer Biografie, nicht aus ihrem jetzigen Leben. Die Eltern und Verwandten, bis gestern noch täglich ganz nahe, spuken in ihrem Kopf herum, bleiben wichtige Personen ihres Lebens. Und ihre Herkunftswelt bleibt in ihrer Zukunft präsent. Als Möglichkeit der Rückkehr, ein stets präsentes Thema, und als bleibende unkündbare verwandtschaftliche Beziehungen, wenn sie selbst bereits volljährig sein werden.
Das ist ihre Welt, mit der sie sich auseinanderzusetzen haben, zu der sie eine Haltung finden müssen – und wie wir aus unserer eigenen Auseinandersetzung mit unseren Eltern, mit unserer Herkunft wissen, ist das eine Auseinandersetzung voll Ambivalenzen, ist sie nie abgeschlossen, beschäftigt uns ein Leben lang.
Der Alltag
Weil es nicht möglich ist, sich täglich neu zu erfinden, und weil wir einen Körper haben, benötigen wir für unser In-der-Welt-sein den Alltag. Die alltägliche Routine des Aufstehens, Essens, Arbeitens, Essens, wieder Arbeitens, Spielens, Streitens, Schlafens. Dem Körper täglich das zu geben, was er braucht, die Pflege des Organismischen unserer Existenz. Die Aufmerksamkeit für die kleinen Verletzungen. Darüber hinaus die Beschäftigung mit den laufend anfallenden Herausforderungen der Arbeit und der Beziehungen.
Wie im familiären Setting ist in einer Fremdunterbringungseinrichtung die Aufrechterhaltung und Herstellung von Alltag, d.h. der Rahmenbedingung für vorerst normales Leben, die erste Aufgabe. Wie in einem familiären Kontext auch hat die Bewältigung und Gestaltung des Alltäglichen Vorrang vor großen Zielen, vor den Träumen von einem besseren Leben. Oder anders gesagt: Die Aufrechterhaltung des Status quo ist schwierig genug. Diese Leistung darf nicht durch die anspruchsvollen Ziele entwertet werden. Es ist eine genuin sozialpädagogische Aufgabe: Die Organisation eines funktionierenden Alltags im Setting der Fremdunterbringungseinrichtung. Entscheidend ist dabei nicht, ob die ErzieherInnen sich in ihm zurechtfinden, obwohl das sicher auch nützlich ist, sondern ob die Kinder und Jugendlichen sich darin zurechtfinden können.

Der Alltag steht vorerst einmal für sich allein: er dient keinem anderen Zweck, als Alltag zu sein, zu „funktionieren“. Hier verschwindet die professionelle Leistung hinter dem Unspektakulären ihres Erscheinungsbilds. Gleichzeitig ist er es doch: er ist professionelle Leistung, weil es ein Alltag unter mehrfach erschwerten Bedingungen ist.
Tatsächlich ist der Alltag in einem Heim, einer sogenannten Wohngemeinschaft, ein anderer Alltag als der familiäre. Ihm geht die Aura der Naturhaftigkeit ab. Für die Kinder und Jugendlichen ist er ein vorerst fremder, und er bleibt ein Alltag auf Abruf, ein gefährdeter. Das macht seine Gestaltung zu einer professionellen Leistung.
Er ist aufrechtzuerhalten und stets neu zu produzieren mit einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen, jedes einzelne davon geübt in den Überlebensstrategien des Dschungels, nicht aber im Zurechtkommen mit der gewöhnlichen Aufmerksamkeit, dem gewöhnlichen Raum. Jede und jeder einzelne mit schwer zu verstehenden Strategien des Wirkens und der Flucht. Und die Kinder und Jugendlichen haben uns voraus, immer da zu sein, während die ErzieherInnen nur Gäste sind, nie so informiert wie die BewohnerInnen.
Unter diesen Bedingungen Sicherheit durch Regelmäßigkeit und Gewohnheit herzustellen, Möglichkeiten der Teilhabe und Unterstützung, das ist schwierige Arbeit. Dazu all die darüber hinausgehenden Ansprüche, was dieser Alltag beinhalten soll: Versorgung, Beobachtung und Freiräume, und jede Menge Aufmerksamkeit.
Ich spreche hier noch nicht von pädagogischen Zielsetzungen. Abseits all der pädagogischen Ansprüche definieren wir die Herstellung der Alltagsförmigkeit des Lebens hier als die erste wesentliche Leistung, als „Produkt“. Und das Gelingen der Alltagsförmigkeit unter erschwerten Bedingungen als Erfolg.
Nicht-Alltag, das ist der Zustand der Krise. Nicht-Alltag, das ist der Zusammenbruch der Routinen, der länger als nötig dauernde Ausnahmezustand. Alltagsförmigkeit, das heißt, dass sich Kinder und Jugendliche darauf verlassen können, dass keine Willkürakte über Tage und Wochen den gewohnten Ablauf erschweren oder verunmöglichen. Nicht-Alltag ist zum Beispiel, dass ErzieherInnen in ihrer Hilflosigkeit als Strafaktion die Waschmaschine nicht reparieren lassen, oder dass wochenlange Ausgeh- und Kontaktverbote als pseudopädagogische Maßnahmen gesetzt werden.
Sie sehen, wenn ich von Alltagsförmigkeit als erstem und basalem Produkt der Fremdunterbringung spreche, dann ist auch gemeint, dass dieser Alltag vorerst einmal nicht von pseudopädagogischen oder pseudotherapeutischen Maßnahmen überformt werden soll. Pädagogik und Therapie sind Zusatzleistungen.
Allerdings gibt es eine Reihe von Leistungen, die in diesen Alltag eines Heims, einer Wohngemeinschaft einzubetten sind. Die oberösterreichische Jugendwohlfahrt hat in einer Kurzbeschreibung der Ziele von Fremdunterbringung von „Angemessenheit“ gesprochen. Angemessenheit, das heißt für uns Individualisierung, ein Zuschneiden und Anpassen der Maßnahmen auf das einzelne Kind, die einzelnen Jugendlichen. Zur Angemessenheit gehört viel, dazu gehört die Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation schon bei der Vorbereitung und der Planung der Maßnahme, dazu später mehr. Um Angemessenheit herzustellen, müssen aber auch eine Reihe von Leistungen in den Heim- und WG-Alltag eingebaut werden:
„Alltag plus“
Was gehört zu so einem „Alltag plus“? Hier einmal eine kleine Liste, in zufälliger Reihung:
a) Aufmerksamkeit für den Körper
Ich habe vom Körper gesprochen als jener Umwelt des ICH, die gleichzeitig Schnittstelle zur Welt ist. Aufmerksamkeit für den Körper, für kleine und kleinste Verletzungen und körperliche Unbehaglichkeiten.
b) Ermöglichen der Wirksamkeit, des wirksamen Eingriffs
Um das Verhältnis von ICH zu Welt entwickeln zu können, muss es die Möglichkeit zu wirksamen Eingriffen geben. Die Welt muss gestaltbar sein, ICH darf zwar manchmal, aber nicht grundsätzlich ohnmächtig sein, um mich erfolgreich abarbeiten zu können am Widerstand der Welt.
c) Ermöglichen des Umweltausgriffs und der positiven Aufmerksamkeit von außen, Eröffnen von Chancen, Gelegenheiten, Verbindung zur „normalen Welt“ (Mentoring anregen)
Die heutige Gesellschaft bietet nur mehr wenige überschaubare Schutzräume. In ihr zu leben ist schwierig und erfordert Flexibilität. Wenn auch die Herkunftssituation der Kinder und Jugendlichen von Grenzenlosigkeit geprägt sein mag: sie benötigen die Außenkontakte, sie benötigen dringend positive Aufmerksamkeit von außerhalb des Heimes, der WG. Und wenn es wenige Kontakte gibt, dann muss man die organisieren. Individuell, für jedes Kind, jede Jugendliche. Viele Personen, die dürfen durchaus in der Distanz bleiben, aber sie sollen grundsätzlich wohlwollend und aufmerksam sein.
d) Ermöglichen der Fortführung bzw. Reparatur, Neujustierung der biografisch relevanten Kontakte
Ich habe ausführlich über die Bedeutung der Herkunftsfamilie, des Herkunftsortes für die Identität und für die Zukunftsperspektive gesprochen. Mit der Fremdunterbringung hört die Arbeit mit der Herkunftsfamilie nicht auf, sondern sie muss unter den neuen Bedingungen neu beginnen. Spätestens hier wird wohl klar, dass das nicht nur Aufgabe der Heime / WGs sein kann, sondern dass wir hier auch von einer Aufgabe der Jugendämter ausgehen.
e) Individualisierung von Aufmerksamkeit und Respekt
Nun, diese Zusatzleistung zum gewöhnlichen Alltag versteht sich wohl von selbst. Individualisierung heißt hier: es geht nicht um das deklamatorische Bekenntnis, sondern um die tatsächliche Aufmerksamkeit auf, den tatsächlichen Respekt vor dem Kind, dem Jugendlichen. Dieser erweist sich zum Beispiel in der Aufmerksamkeit gegenüber Einwänden und Beschwerden, Gefühlen und Wünschen, in der Bereitschaft zur Verhandlung. Wenn man so will, in der Bereitschaft, Ausnahmen zu machen.
f) Pläne schmieden, verwerfen, Misslingen
Und schließlich ist an einer Perspektive zu arbeiten, an Plänen. Weil die Welt sich ändert, weil die Weltsicht sich ändert, weil die Gelegenheiten sich ändern und weil man morgen vielleicht schon klüger ist als heute, daher können und müssen sich auch die Pläne ändern. Flexibilität ist angebracht, die der Planung erst menschliche Dimensionen verleiht.
Unordnung und Planung
Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Vorbereitung auf meinen Vortrag bin ich bis hierher gekommen, und dann ging nichts mehr weiter. Ich hatte eine Reihe von Notizen und ein Fülle von Gedanken, aber all das wollte sich nicht in eine Ordnung fügen.
Der Gedanke lag nahe, dass diese Unordnung nicht nur meine persönliche ist, sondern dass sie dem Thema anhaftet. Ab sofort also: Unordnung in meinem Vortrag.
Und weil wir schon bei der Unordnung sind, können wir ja weiter über Planung sprechen.
Ach ja, die Planung.
In meinen Notizen stand der Satz:
„Fremdunterbringung ist kein Fleischlaberl mit Salatblatt. Bei der Produktion von Hamburgern, von Nägeln und von Autos führt die Ausführung der immergleichen, präzise beschriebenen und normierten Routinen zum Erfolg, führt zur vorweg definierten Qualität.“
Wenn ich die Produktion von Alltag und „Alltag plus“ als die zentrale Dienstleistung der Fredmunterbringungeinrichtung charakterisiert habe, dann lässt sich doch einiges planen, organisieren und dokumentieren. Zuallererst wird diese Planung allerdings eine Planung der Organisation für sich sein müssen, nicht so sehr eine dem Kind, der Jugendlichen auferlegte Planung.
Oder andersrum gesagt: Es gibt zwar einen Zusammenhang von Planung, Organisation und Qualität des Produkts, aber das Produkt ist eben nicht das Gelingen des Lebens der Kinder/Jugendlichen. Das Produkt ist der Heimalltag, ist die Förderung der Kinder.
Ob Kinder für sich einen Lebensplan haben, ob sie diesen mit den BetreuerInnen aushandeln und besprechen, das kann nicht erzwungen werden.
Die Übernahme eines Lebensplans, der motivierend und steuernd sein kann, ist eine subjektive Entscheidung. Er kann nicht verordnet werden. Und wenn er vorgeschlagen wird, dann sollte er zumindest realistisch sein.
Es bleiben stets noch andere Lebenspläne in Konkurrenz zum verordneten, zum vereinbarten oder „offiziellen“: der Lebensplan der Herkunftsfamilie, aber auch die Lebenspläne von MitbewohnerInnen und Peers außerhalb des Heimes.
Der Lebensplan der Kinder, Jugendlichen ist also kein Gegenstand der Verhandlung. Er gehört ihnen. Sie besprechen ihn vielleicht, und man kann ihnen erzählen, was man selbst sich vorstellen kann an Zukunften. Man kann erzählen, man sollte keinesfalls verordnen.
Die Normalität des Misslingens
Dann fand ich noch eine Notiz, und die erwies sich als besonders sperrig: Die Notiz lautete:
Die Normalität des Misslingens. Im Leben und vor allem im Leben von Kindern misslingt ständig irgendwas, auch in der Erziehung erreicht man immer wieder nicht das, was man erreichen wollte. Das Leben erfüllt nicht meine Wünsche, sondern in den besten Momenten erfüllt es Wünsche, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe.
Dann habe ich einen Essay über Fußball und Filmkunst gelesen (es handelt sich beim genannten Verhältnis übrigens um ein wenig glückliches), und fand darin diesen Satz:
„Die Grundstimmung der Fußballfernsehübertragung ist die Melancholie. Das meiste, was während der Übertragung zu sehen ist, misslingt, und doch bleibt man dabei, in der Hoffnung, Zeuge eines unverhofften Gelingens zu werden, das sich an den besten Momenten messen lässt, an die man sich noch erinnert.“ (Hediger 2006)
Na schau, der Autor scheint über schwierige kindliche Welterfahrungen zu sprechen. Das Misslingen ist alltäglich in der Lebensführung, das Gelingen selten. Das Misslingen ist allerdings auch Teil erzieherischer und sozialarbeiterischer Praxis, und zwar nicht der geringste.
Ungefähr so:
Misslingen ist Teil der beruflichen Performance, und ein Qualitätsbegriff, der das Misslingen nicht als selbstverständlichen Teil der guten Arbeit umfasst, verkommt zu purem Gewäsch, fördert den Bau potemkinscher Dörfer.
Im Fußball weiß man, dass man nichts wirklich erzwingen, nicht vorausplanen kann, dass der Ball ins Tor geht. Wie reagiert man darauf? Man versucht alles zu tun, damit sich die Zahl der Möglichkeiten erhöht. Dann kann man mit gutem Grund hoffen, dass er einmal doch drin ist.
Von einem ähnlichen Verhältnis zwischen Arbeit und erzieherischem Ergebnis ist wohl bei den pädagogischen Interventionen auszugehen.
Mir hat eine Studentin in den letzten Tagen eine interessante Fallstudie (Tajti 2006) vorgelegt. Eine 17-jährige Jugendliche , seit 2 Jahren im Heim, hatte zuerst die üblichen Schwierigkeiten gemacht, war ausgerissen, schmiss ihre Lehrstelle hin und so weiter, inzwischen funktioniert alles bestens, sie hat für sich eine Entscheidung getroffen, verfolgt ambitioniert eine Berufsausbildung usw., also alles, was man sich so wünschen kann. Die Studentin interviewte die 17-jährige Valentina, weil diese Wendung so erstaunlich ist, eigentlich so unerwartbar. Man will es, aber wenn´s jemand schafft, kann man´s nicht glauben. Valentina schreibt ihren neuen Lebensplan einerseits sich selbst zu, das ist ja gut. Sie sagt, dass ein Erlebnis mit ihrer Familie dazu beigetragen hat, und sie sagt diesen Satz:
„Vielleicht ist man manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und begegnet den gerade richtigen Leuten!“ (Valentina, 17 Jahre)
Dem Heim schreibt sie als Erfolg zu, dass sie durch das Heim einen Freund kennenlernen konnte, mit dem sie sich verstand, der ähnliche Erfahrungen hatte, und der ihr die richtigen Fragen stellte. Das Zurverfügungstellen solcher Chancen, das machte für sie die Qualität aus.
Damit ist auch gesagt, dass sich das weitere Leben, das Schicksal von ICH, nicht unbedingt im Heim, in der Wohngemeinschaft entscheidet, nicht einmal in der Herkunftsfamilie, sondern außerhalb. Die Produktion solcher Möglichkeiten, das wäre auch als Qualität von Fremdunterbringungseinrichtung zu definieren.
Ich habe nun den Fokus verschoben. Die Gestaltung, Ermöglichung von produktiven Beziehungen der Kinder und Jugendlichen nach außen wird zum Qualitätskriterium, zur Bedingung der Möglichkeit von Erfolg für das ICH, für Lebensführung.
Kürzlich fiel mir eine britische Untersuchung in die Hand, die sich mit den Chancen von Jugendlichen beschäftigte, die in devianten Cliquen aktiv waren. Es wurde untersucht, welche von ihnen später den Einstieg in ein nicht-deviantes Leben schafften. Interessant war, dass offensichtlich eines der wichtigsten Kriterien war, ob die Jugendlichen auch während ihrer Cliquen-Aktivitäten Kontakte nach ganz „draußen“ hatten, schwache, aber aufrechte Beziehungen zu Personen in der „normalen“ Welt, hinreichend „soziales Kapital“ (Boeck u.a. 2006).
Die Fremdunterbringung ist letztlich meist bloß eine Episode im Leben der Menschen, aber sie ist ein Bruch, ein dramatisches Ereignis. Sie unterbricht, akzentuiert den Fluss des Lebens. Sie ist in diesem Sinne hochgradig erklärungsbedürftig, und man kann diesen Erklärungsbedarf nicht den Kindern / Jugendlichen allein anlasten. Unterbringung, Weiterführung, Rückführung sind ständig erklärend und dialogisch zu begleiten, und diese Begleitung muss organisatorisch abgesichert werden.
Eine zerrissene Biografie kann nicht allein vom betroffenen ICH zusammengehalten werden. Es sollte viele Personen geben, zumindest aber eine sehr aufmerksame, die nicht müde wird, den Kindern und Jugendlichen zu erklären, was passiert, und ihnen zu versichern, dass sie die gleichen sind und bleiben, vor und nach dem oft erzwungenen Weg ins Heim, aber auch dann, wenn sie ihn selber veranlasst haben.
Kontinuität ist ein Qualitätsmerkmal, und, ja, Kontinuität ist sogar messbar.
Nun zum Schluss.
Ich habe mit Überlegungen zur Lebensführung begonnen, zur Logik von Leben und Alltag. Ich habe gezeigt, dass die Frage nach dem Erfolg die Grenzen der Organisation, des Organisierbaren überschreitet. Für unsere Frage nach den Kriterien und der Messbarkeit der Qualität in der Fremdunterbringung heißt das, dass wir fehl gehen, wenn wir sie nur in der Fremdunterbringungseinrichtung suchen, dass es vielmehr um eine umfassende Herstellung von lebensweltlichen Möglichkeiten geht. Dazu bedarf es einer flexiblen und sorgsamen Steuerung des Gesamtprozesses, in der Jugendämter, Einrichtungen und Verwandte – auch entfernte Verwandte –, alle, die Verantwortung haben für die Kinder und Jugendlichen, eingebunden sein müssen.
An der Herausforderung, das in Standards und Vergabeleitsätze zu gießen, versuchen wir zu arbeiten.
Für den Erfolg im Einzelfall, für gelingende Lebensführung, brauchen wir dann nur noch etwas Glück.
Literatur
Ader, Sabine (2006): Was leitet den Blick? Wahrnehmung, Deutung und Intervention in der Jugendhilfe. Weinheim und München.
Boeck, Thilo / Fleming, Jennie / Kemshall, Hazel (2006): The Context of Risk Decisions: Does Social Capital Make a Difference?. In: Forum Qualitative Sozialforschung (Online Journal), 7(1), Art. 17: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-06/06-1-17-e.htm am 7.2.2006.
Finkel, Margarete (2003): Zur Messbarkeit der Leistungen von Heimerziehung. In: Möller, Michael (Hg.): Effektivität und Qualität sozialer Dienstleistungen. Ein Diskussionsbeitrag. Kassel. S. 26-49.
Hediger, Vinzenz (2006): Von der notwendigen Niederlage des Fußballs im Film. Weshalb Film und Fußball ein schlechtes Team bilden – im Unterschied zu Fernsehen und Fußball. In: Neue Zürcher Zeitung Nr. 131 vom 9.6.2006. S. 63.
Tajti, Caroline (2006): Fallstudie Valentina K. – Der Nutzen sozialer Dienstleistungen (?) im Hinblick auf die eklatant positive Veränderung und Lebensführung der Klientin Valentina K. Unveröffentlichte Seminararbeit im Diplomstudiengang Sozialarbeit an der FH St.Pölten. St. Pölten.
Volz, Fritz-Rüdiger (1993): „Lebensführungshermeneutik“. Zu einigen Aspekten des Verhältnisses von Sozialpädagogik und Ethik. In: neue praxis Nr. 1+2. S. 25-31.
Willke, Helmut (1994): Systemtheorie II: Interventionstheorie. Stuttgart.
|